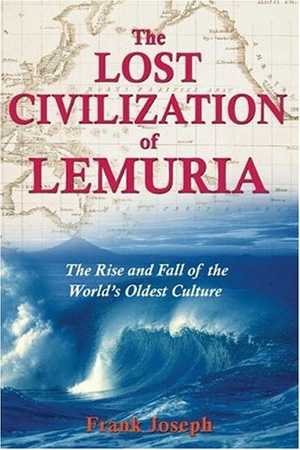The Lost Civilization of Lemuria - The Rise and Fall of the World´s Oldest Culture
Dieser Beitrag ist noch in Arbeit!
Rezension
"Mündliche Überlieferungen in Polynesien erzählen die Geschichte eines glanzvollen Königreichs, das von einer mächtigen >Krieger-Welle< - einen Tsunami auf den Meeresgrund befördert wurde. Dieses verschollene Reich ist auch in zahlreichen anderen indigenen Überlieferungen erwähnt worden, die den Globus von Australien über Asien bis zu den Küsten von Süd- und Nordamerika umspannen. Es ist als Lemuria oder Mu bekannt, ein gewaltiges Gebiet von Inseln und Archipelen, das sich einst über den Pazifischen Ozean erstreckte. Auf der Grundlage von zehn Jahren Forschung und ausgedehnten Reisen, offeriert Frank Joseph ein fesselndes Bild dieses Mutterlandes der Menschheit, welches er als den ursprünglichen 'Garden Eden' betrachtet." (Verlagstext)
(bb) Seit David Hatcher Childress´ schon fast legendärer Publikation "Lost Cities of Ancient Lemuria & the Pacific" aus dem Jahr 1988 warteten viele Freunde der alternativen Urgeschichtsforschung und Primhistorik vergeblich darauf, dass jemand mit der nötigen Kompetenz den von Hatcher Childress gespielten 'Ball aufnehmen', und - in klarem Kontrast zum üblichen 'Channelling-Brimborium' esoterischer "Lemuria-Jünger" - weiterführende, rationale Studien zum Lemuria-Problem vorlegen würde.
Im Jahr 2006 war es dann endlich soweit, als Frank Joseph mit "The Lost Civilization of Lemuria - The Rise and Fall of the World’s Oldest Culture" ein veritables neues Standardwerk in Sachen Lemuria-Forschung präsentierte, das sich inhaltlich wie auch methodologisch an den Usancen moderner, nonkonformistischer Atlantisforschung orientiert - was zumindest diejenigen kaum verwundern wird, die über etwa zwei Jahrzehnte hinweg seine kontinuierliche Entwicklung zu einem der profiliertesten atlantologischen Fachbuchautoren der Gegenwart mitverfolgt haben.
The Lost Civilization of Lemuria stellt als Grundlagenwerk zum Komplex einer putativen, primhistorischen Mutterkultur des alt-pazifischen Großraums zunächst eine mehr als beachtliche Sammlung von Indizien aus dem Bereich der Mythologie dar, welche durch zahlreiche, hierzulande kaum bekannte archäologische Entdeckungen ergänzt werden, die Joseph - wie zuvor auch Hatcher Childress - nicht vom Schreibtisch aus interpretiert, sondern größtenteils im Feld, bei seinen Studienreisen, kennen gelernt hat.
So begleiten F. Joseph LeserInnen ihn auf einer ebenso spannenden wie umfassenden Tour de Force, die auf den Karolinen-Inseln beginnt, wo er sich mit der Geschichte der rätselhaften Anlagen von Nan Madol (Abb. 2) auf der Insel Pohnpei und von Insaru auf dem Inselchen Lelu vor Kosrae, sowie offenbar weitaus älteren artifiziellen Relikten in den Gewässern vor einigen der heutigen Karolinen. Dazu wirft der Autor die Frage auf, ob es sich bei den Anlagen von Nan Madol und Lelu und ihren magnetischen Anomalien möglicherweise vormals um eine technische Anlage zur Wetter-Beeinflussung und Auflösung von Zyklonen gehandelt haben könne.
Die Suche nach Spuren einer putativen Hoch-Technologie, über welche die vermuteten Uralt-Pazifiker (und möglicherweise noch späte Nachfahren derselben) verfügt haben könnten, zieht sich ebenso wie ein 'Roter Faden' durch Josephs Werk, wie seine akribische Sammlung von Indizien für kulturelle Diffusions-Prozesse im Pazifik-Raum. Auf der Osterinsel, seinem nächsten Reiseziel, geht er z.B. sowohl Indizien für die Existenz eines vormaligen Mutterlands - Mu - als auch für spätere, transozeanische Verbindungen zwischen der Insel, Peru und Altindien nach.
Außerdem unterzieht er auch die "Moai" (Abb. 3), jene "heiligen Statuen" der Osterinsel und ihre Entstehungsgeschichte, bzw. die gängigen schulwissenschaftlichen Vorstellungen dazu einer kritischen Überprüfung, die in krassem Widerspruch zu den Ursprungsmythen der Insulaner stehen. Diese besagen, dass Hotu Matua, der Begründer der Rapa Nui-Kultur, seine Familie und Gefolgschaft aus ihrem Heimatland geflüchtet seien, das, von Meteoriten getroffen, in einer kataklysmischen Sintflut untergegangen sei. Solche Ereignisse hat es jedoch während des 5. oder 6. nachchristlichen Jahrhundert (dem Zeitraum, in dem die Osterinsel der wissenschaftlichen "Mehrheitsmeinung" nach besiedelt worden sein soll) in diesem Großraum mit einiger Sicherheit nicht gegeben...
Einen nächsten Zwischen-Stop bei seiner alternativ-historischen Rundreise legt Frank Joseph auf der melanesischen Insel Kunie (Île des Pins) im Gebiet Neukaledoniens ein. Bereits die zahlreichen und zudem enorm hochwüchsigen Pinien (Araucaria cookii), denen diese Insel ihren französischen Namen verdankt, stellen ein Rätsel für sich dar, denn sie wachsen und gedeihen sonst nirgendwo im Pazifikraum. Noch weitaus rätselhafter jedoch sind die mysteriösen 'Hillocks' ("Hügelchen") Kunies, die 1961 zum ersten mal wissenschaftlich untersucht wurden, da man sie zuvor als naürliche Formationen betrachtet hatte. Luc Chevalier, der sie damals im Auftrag des Museums von Neukaledonien begutachtete, sollte feststellen, ob es sich bei diesen Strukturen, von denen nach Schätzung von David Hatcher Childress etwa 10.000 auf der Insel existieren, womöglich doch um Grabhügel einer alten Insulaner-Kultur handeln könne. Zu seinem Erstaunen ergaben die Grabungen, dass sich in den meisten 'Hillocks' aufrecht eingelagerte Zylinder aus einem extrem harten, mit Muschelsplittern durchsetzten, Zement befanden. Die Außenfläche dieser, etwa 7 Fuß (ca. 2,13 m) und langen und 2 Fuß (ca. 61 cm) breiten Zylinder war mit einer Art Kies mit hohem Quarz- und Eisenanteil besprenkelt. Mittels Radiokohlenstoffdatierung von Muschelpartikeln dieser Objekte wurde ein Alter der Objekte von annähernd 13.000 Jahre ermittelt.
Natürlich löste diese Entdeckung hektische Abwehr-Reaktionen seitens des wissenschaftlichen Mainstreams aus, denn zu dieser Zeit dürfte es nach schulwissenschaftlicher Ansicht so etwas wie Zement noch gar nicht gegeben haben, und Menschen sollen im Pazifikraum auch noch nicht präsent gewesen sein. Da an der Alterbestimmung nicht zu rütteln war - Querprüfungen ergaben, dass die Zylinder definitiv zwischen 10.950 v. Chr. und 5120 v. Chr. entstanden sind - wurden seitens der 'Skeptiker' diverse skurrile Ideen vorgelegt, um diese brisanten Funde zu 'enschärfen', darunter die Erfindung einer hypothetischen, ausgestorbenen Riesen-Vogelart, welche die Hügel samt ihrem Inhalt beim Nestbau produziert haben soll. Josephs spekulative Überlegungen, ob es sich bei den zur Diskussion stehenden Specimen ebenfalls um eine Technologie zur Beeinflussung des Wetters gehandelt haben könne, wirken im Vergleich damit nüchtern und geradezu konservativ!
Nach 'Stippvisiten' auf Tonga, wo er weitere Indizien und Evidenzen für eine prähistorische Technologie ausmacht, und den Marianen-Inseln Mikronesiens mit ihren enigmatischen ladhe oder Latte-Steinen, reisen wir mit Frank Joseph weiter nach Babeldaob, der größten Insel der heutigen Republik Palau, wo sich nicht nur steinerne Statuen finden, die den bereits erwähnten Moai der Osterinsel ähneln: "Vor Jahrtausenden waren fünf Prozent der insgesamt 153 Quadratmeilen von Babeldaob zu Terrassen für die Produktion von Nahrungsmitteln umfunktioniert worden. Der Umfang dieses landwirtschaftlichen Projekts war so gewaltig, dass seine Erträge hunderttausende von Menschen versorgen konnten, viel mehr als jemals Palau bewohnt haben. Die Terrassen wurden nicht einzeln, nach und nach, aus ihrer Umgebung heraus gearbeitet. Vielmehr formte eine Armee von Landschaftstechnikern, einem umfassenden Plan folgend, Babeldaobs Hügel zu einem einzigen, immensen Verbindungssystem um. Ihre Terrassen sind einheitlich 15 Fuß hoch, und variieren in der Breite zwischen dreißig und sechzig Fuß, wobei sie genau so nach innen geneigt, dass sie Regenwasser auffangen, ohne überflutet zu werden. Einige Hügel wurden vollständig in landwirtschafliche Anlagen umgewandelt, was sie Stufenpyramiden ähnlich macht. Radiokarbon-Tests zeigen, dass die Terrassen, wenn auch weit unterhalb ihrer vollen Kapazitäten, noch vor annähernd 2000 Jahren in Betrieb waren, und schließlich um 1200 n. Chr. aufgegeben wurden, aber sie geben keinen Aufschluss darüber, wann sie angelegt wurden." [1]

Abb. 5 Panorama-Ansicht der gewaltigen 'Reis-Terrassen von Banaue' auf Luzon - nach Frank Joseph eine der 'Kornkammern' der lemurischen Kultur.
Joseph verweist zu Recht auf die markante Ähnlichkeit dieser Anlagen mit entsprechenden Strukturen auf der Philipinen-Insel Luzon: "Es ist jedenfalls klar, dass sie zu der selben Hochkultur gehören, die Träger der weit entfernten Reis-Terrassen von Banaue (Abb. 5) waren, welche sich von denen Babeldaobs lediglich durch ihren noch gewaltigeren Umfang unterscheiden. Zusammengenommen könnten die Mega-Plantagen von Luzon und Mikronesien Millionen von Menschen ernährt haben, was einen Hinweis liefert, wie zahlreich die Bevölkerung Lemurias am Höhepunkt seiner Zivilisation war." [2]
Weitere Spuren der vermuteten le(mu)rischen Mutterkultur macht Frank Joseph auf Neuguinea aus, wo es u.a. uralte Megalithen zu bestaunen gibt, welche manche Ureinwohner, wie etwa der Stamm der Kai mit einer, Ne-Mu genannten, hellhäutigen Rasse von Riesen identifiziert, die dort vor der Großen Flut gelebt haben sollen. "...Abkömmlinge der Ne-Mu überlebten", wie wir bei ihm erfahren, "noch bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein. Ein Science-Artikel von 1937 sprach von den relativ hellhäutigen Tarifyroro, die im fast unzugänglichen Hinterland [...] siedelten. >Irgendwann einmal bewohnten<, Jack Hides, einem ortsansässigen Richter aus Neuguinea zufolge, >diese hellhäutigen Menschen das gesamte Tafelland, und wurden dann von den virileren Papuas nach Westen abgedrängt.< Er beschrieb die landwirtschaftlichen Methoden der Tarifyroro als >die besten, die ich jemals gesehen habe<." [3] In der Tat finden sich noch heute in den nahezu undurchdringlichen Dschungeln und Sümpfen der Großinsel nur aus der Luft erkennbare Spuren viele Jahrtausende alter hochstehender Agrikultur. Die wohl ältesten Relikte dieser Art (Abb. 6) befinden sich in den Kuk-Sümpfen bei Mount Hagen. Um etwa 3000 v. Chr. scheint es auf Neuguinea sogar, wie Joseph erklärt, eine regelrechte Explosion der gegeben haben, die er mit einem vermutlich rapiden Anstieg der Bevölkerung durch Neuzuwanderer in Verbindung bringt: 'Lemurier', die aufgrund, von gravierenden Naturkatastrophen den zentralpazifischen Raum verlassen mussten?
Eine weitere Station auf Frank Josephs Suche nach den Spuren Lemurias ist Mulifanua auf der Samoa-Insel Upolu
When disaster struck Lemuria, the survivors made their way to other parts of the world, incorporating their scientific and mystical skills into the existing cultures of Asien, Polynesia, and the Americas. Totem poles of the Pacific Northwest, architecture in China, the colossal stone statues on Easter Island, and even the perennial philosophies all reveal their kinship to this now-vanished civilization.
The Lost Civilization of Lemuria - The Rise and Fall of the World’s Oldest Culture von Frank Joseph; 17. 05. 2006 erschienen bei Bear & Company, Rochester (Vermonth, USA); 360 Seiten, darunter 8 Farbseiten und 25 s/w Illustrationen; Preis: $ 20.00; ISBN-13: 978-1-59143-060-5 / ISBN: 1-59143-060-7
Anmerkungen und Quellen
- ↑ Quelle: Frank Joseph, The Lost Civilization of Lemuria - The Rise and Fall of the World’s Oldest Culture, S. 110-111
- ↑ Quelle: ebd., S. 111
- ↑ Quelle: ebd., S. 113
Bild-Quellen
1) Bear & Company, unter: The Lost Civilization of Lemuria - The Rise and Fall of the World’s Oldest Culture
2) Wikipedia - Die freie Enzyklopädie, Stichwort: Pohnpei
3) Wikipedia - The Free Encyclopedia, Stichwort: Nan Madol
4) Jan Erik Johnsen, Babeldaob Photo Gallery
5) Wikipedia - The Free Encyclopedia, Stichwort: Banaue Rice Terraces
6) Peter Marsh, Lapita Pottery & Polynesians
7) Robert Bast, Survive 2012, unter: Asia & Pacific Pyramids